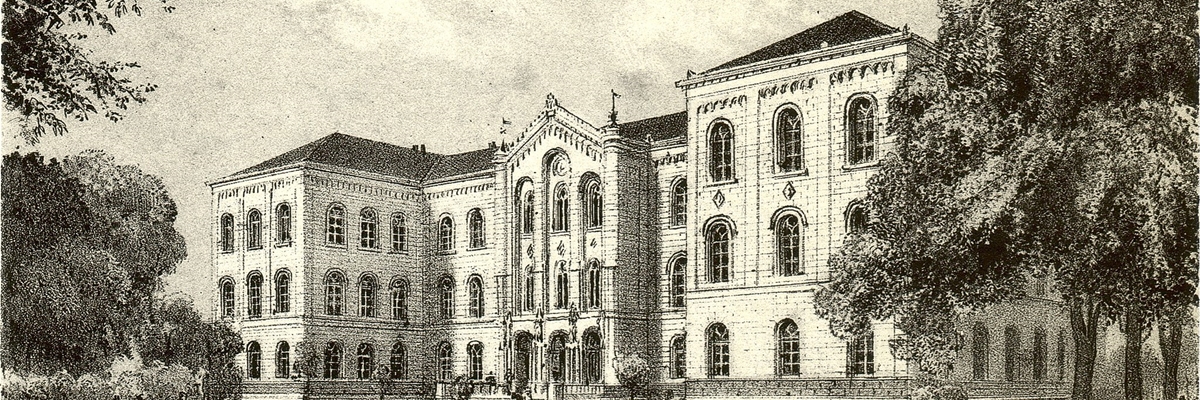Warum fertigten Briten eine detaillierte Karte Indiens an, bevor es eine vergleichbar genaue Karte von Großbritannien gab? Und an wessen Kenntnisse knüpften sie dabei an? Wie kommt es, dass Cannabis in den 1840ern in britischen Apotheken legal erhältlich war? Wer übersetzte erstmals die Lutherbibel in eine afrikanische Sprache? Wo und mit wessen Hilfe erlangte Robert Koch wegweisende Kenntnisse über die Cholera? Und warum machen jetzt alle Yoga?
Wer eine Antwort auf diese Fragen finden will, kommt nicht umhin, sich mit der Verbindung von Wissen(schaft) und Kolonialismus auseinanderzusetzen.
Die Forschung
Diese zwei Felder, Wissenschaft und Kolonialismus, wurden von HistorikerInnen lange Zeit getrennt betrachtet. So forschten die einen zum Kolonialismus, während die anderen sich um die Geschichte des Wissens und der Wissenschaft kümmerten. Bis in die 1980er Jahre glichen sich die Thesen und Erzählungen dieser Felder trotzdem: In beiden Bereichen wurden häufig die Errungenschaften weißer europäischer Männer ins Zentrum der Geschichte gerückt. Für die Kolonialgeschichte hieß das, dass die Kolonisierten nicht zu Wort kamen und ihre Perspektiven und Handlungen in der Geschichtsschreibung keine Rolle spielten. Übrig blieben Erzählungen über britische Kolonialbeamte, die ganz Indien unter Kontrolle hätten oder Berichte über die Großtaten deutscher MissionarInnen in den deutschen Kolonialgebieten. Im Bereich der Wissenschaftsgeschichte verschwanden AssistentInnen, Ehefrauen, SchülerInnen, PatientInnen und viele mehr aus den Erzählungen. An deren Spitze standen dann häufig Ärzte wie Robert Koch, denen sogleich auch der Mythos des Genies und heroischen Einzelgängers anhaftete.
Die Ideen, mit denen die überwiegend männlichen und weißen Historiker aufwarteten, als man die beiden Felder Kolonial- und Wissensgeschichte zusammenbrachte, überraschend zunächst wenig: Vor allem in der westlichen Welt fand die Vorstellung Anklang, in der Mitte des 18. Jahrhunderts seien die Errungenschaften der europäischen Moderne hinaus in die restliche Welt getragen worden. Dieses Diffusionsmodell inszenierte Europa einerseits als Ursprungsort der Wissenschaften und machte gleichzeitig deutlich, dass die westlichen Wissenschaften universal anwendbar und für alle überall gültig waren. Der Einfluss von außereuropäischen Kulturen auf europäische WissenschaftlerInnen wird in diesem Modell vollständig negiert, der Einfluss der alten Griechen dagegen meist überbetont. Heute ist die Wissenschaft deutlich diverser aufgestellt – und so auch ihre Erkenntnisse. Besonders mit dem Einzug der postcolonial studies in den universitären Kanon wurden solche eurozentrischen Vorstellungen in Frage gestellt und HistorikerInnen aus verschiedenen Teilen der Welt konnten zeigen, dass die Geschichte des Wissens verflochten ist. Wissen, das wird bei einer näheren Quellenbetrachtung deutlich, bewegt sich nicht entlang des Gefälles Metropole/Peripherie oder Westen/der Rest der Welt, sondern zirkuliert vielmehr. Darüber hinaus wurde in der jüngeren Forschung deutlich, dass die Einteilung in „westliches Wissen“ und „nicht-westliches Wissen“ der Realität nicht gerecht wird. Schließlich gab es auch innerhalb der jeweiligen Regionen miteinander konkurrierende Wissenssysteme, man hatte es also nicht mit einem einzigen unangefochtenen Standard zu tun. Gleichzeitig kam es besonders in den kolonialen Kontaktzonen zur Verschmelzung, Adaption und Veränderung verschiedener Wissenssysteme, sodass schwer zu sagen wäre, welchem Wissen man das Endprodukt nun zuordnen sollte.
Globales Wissen?
Werfen wir also einen kurzen Blick auf die Jahrhunderte kolonialer Herrschaft. Der Geograph David Harvey beschreibt, wie es in der Hochphase des Kolonialismus zu einer Zeit-Raum Kompression kommt: mit dem Dampfschiff konnte man Distanzen deutlich schneller zurücklegen als zuvor, später machte die Erfindung des Telegraphen Kommunikation rascher und einfacher möglich, immer mehr Teile der Welt wurden an Schienennetze angebunden, um den imperialen Handel voranzutreiben – kurz: die Welt schrumpfte. Nicht nur Menschen und Waren konnten so schneller von Ort zu Ort reisen, auch Wissen zirkulierte schneller und über größere Distanzen hinweg. Dabei überwanden die verschiedenen Wissenssysteme „kulturelle, staatliche und ethnische Grenzen.“ Das zirkulierende Wissen lässt sich schwer in die Kategorien „lokal“ oder „global“ einteilen. Die AkteurInnen der Geschichte des Wissens bewegten sich in Räumen, die wir mit diesen Begriffen nicht fassen können. Netzwerke wurden geschaffen, genutzt oder zerschlagen; manche von ihnen waren kurzweilig, andere von Dauer; mal wurden die Netzwerke in statische Formen wie Institutionen gegossen, dann wiederum existierten nur lose Verbindungen.
Es wäre allerdings weit gefehlt, zu glauben, die verschiedenen Wissenssysteme und ihre AkteurInnen hätten in dieser zunehmend vernetzten Welt gleichberechtigt koexistiert oder einander anerkennend befruchtet. Im Zeitalter der europäischen Expansion waren die EuropäerInnen besonders darum bemüht, WissenschaftlerInnen oder Erkenntnisse und Methodik aus den kolonisierten Regionen zu diskreditieren, um ihre eigene Überlegenheit zu demonstrieren. Beispielhaft hierfür ist das von KolonialherrInnen gerne genutzte Narrativ der „Civilizing Mission“, das besonders prominent in Rudyard Kiplings („Das Dschungelbuch“) Gedicht „A White Man’s Burden“ zum Ausdruck kommt. Kern dieser Rechtfertigungsstrategie war die Behauptung, die EuropäerInnen wären dem Rest der Welt zivilisatorisch (und das schließt den Stand der Wissenschaften mit ein) weit überlegen und hätten die schwere Aufgabe, ihr Wissen weiterzugeben und den Rest der Welt zu erziehen. Manches Wissen, besonders aus den Kolonien, ist während dieser Zeit verloren gegangen oder aktiv unterdrückt worden. Die Unterdrückung der Kolonisierten erscheint in dieser Erzählung als altruistische Geste: man wolle ja nur helfen und die Menschen von ihrem Irrglauben befreien, sie auf dem vorgegebenen Pfad der Entwicklungsstufen ein wenig vorantreiben. Eine Erzählung, die uns auch heute im Bereich der sogenannten „Entwicklungshilfe“ immer wieder begegnet.
Doch konnten die europäischen KolonialherrInnen ohne die Erkenntnisse aus den Regionen, über die sie Herrschaftsansprüche erhoben, überhaupt bestehen?
Wissen und Macht
Ohne das Wissen der Menschen aus den kolonisierten Regionen wäre der Kolonialismus kaum denkbar gewesen. Die KolonialherrInnen waren von Beginn an auf die Kollaboration mit oder/und die Ausbeutung von lokalen Eliten, ÄrztInnen, HändlerInnen, ArbeiterInnen und anderen Ortskundigen angewiesen, um ihre Herrschaft aufbauen und aufrecht erhalten zu können. Denn, wie Bernhard Schär es in Bezug auf die Kartographie knapp formuliert: „Wer ein Territorium erobern und beherrschen will, muss es kennen.“ Das gilt nicht nur für die geographische Beschaffenheit eines Raumes, sondern auch für seine Sprache und Kultur.
Manche Wissenschaften hatten einen ganz praktischen Wert für die koloniale Mission der EuropäerInnen, andere dienten dazu, das ideologische Fundament des Kolonialismus zu untermauern. Generell gilt es, die Entstehungsgeschichte vermeintlich europäischen Wissens zurückzuverfolgen und sichtbar zu machen, welchen Anteil die Kolonisierten an ihr haben. Denn obschon der Kolonialismus von Unterdrückung und Ausbeutung geprägt war, konnte er die Menschen in den Kolonien nie gänzlich ihrer Handlungsmacht berauben. Ihre Expertise floss in die Wissensproduktion, genauso wie ihre körperliche Arbeit – zwei Umstände, die man nicht zwangsweise voneinander trennen muss oder kann. Dieses Wissen, ebenso wie die Erkenntnisse, die man durch Expeditionen und Experimente in den kolonisierten Gebieten gewann, wurde meist wieder zurück an die heimatlichen Universitäten und Forschungsstätten getragen und dort ins westliche Wissenssystem eingespeist. EuropäerInnen veröffentlichten es in Fachzeitschriften und Büchern, stellten es in Museen zur Schau, fügten es zu ihren Sammlungen hinzu und integrierten es in den akademischen Kanon, ohne seiner Entstehungsgeschichte Rechnung zu tragen. Von EuropäerInnen wurde schließlich festgesetzt, was wissenschaftlich war und was nicht, welche Worte man in die neu entstehenden Wörterbücher aufnehmen würde und welche nicht – wer zivilisiert war und wer nicht. Derweil machten WissenschaftlerInnen, Gelehrte, Kaufleute oder Fabrik- und PlantagenbesitzerInnen aus der westlichen Welt mithilfe der neuen Erkenntnisse Karriere, während den meisten Kolonisierten Reichtum und Anerkennung verwehrt blieben.
Verschiedene Disziplinen und ihrer kolonialen Vergangenheiten
Tatsächlich fallen der Kolonialismus und die Ausdifferenzierung wissenschaftlicher Disziplinen zusammen, manche wissenschaftlichen Fächer entstanden sogar erst im kolonialen Kontext.
Es ist kein Zufall, dass man sich auch an deutschen Universitäten beispielsweise mit Fragen rund um die Baumwollpflanze beschäftigt, um deren optimale Verwertung in den Kolonien voranzutreiben. Schließlich war eine Kolonie immer auch eine ökonomische Angelegenheit. Die Ressourcen und Rohstoffe wollten die KolonialherrInnen und Kaufmannsleute möglichst gewinnbringend verarbeiten und verkaufen, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen war dafür die Grundlage. In der Forstwissenschaft, aber auch in der Botanik oder der Geographie wurde zunehmend für die Kolonien geforscht. Ohne die lokale Bevölkerung wären die europäischen Forschungsprojekte allerdings nicht möglich gewesen. Schließlich brauchte man die Hilfe derer, die mit der Umgebung vertraut waren. Menschen aus den kolonisierten Regionen sammelten Pflanzen, führten die KolonialherrInnen durch für diese unbekannte Regionen, trugen ihr Gepäck und so weiter. Nicht selten bedienten die EuropäerInnen sich an den bereits vorhandenen Erkenntnissen: Der Historiker Kapil Raj zeigt beispielsweise, wie britische KolonialherrInnen auf das Kartenmaterial des indischen Moghulreiches zurückgriffen und vor Ort neues Material von lokalen KartographInnen erstellen ließen.
Das Beispiel des Göttinger Mediziners Alfred Leber, der im Auftrag des Reichskolonialamtes eine Forschungsexpedition in die sogenannte „Deutsche Südsee“ unternahm, zeigt, dass es ebenfalls im ökonomischen Interesse der Kolonialmächte war, für die Gesundheit der kolonisierten Bevölkerung zu sorgen – zumindest dann, wenn ihre Fähigkeit zu arbeiten sonst eingeschränkt wäre. Denn ohne die Arbeitskraft der lokalen Bevölkerung war es um die begehrten Kolonialwaren schlecht bestellt. Gleichzeitig war es zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich, dass MedizinerInnen die Kolonien quasi als Laboratorien nutzten, in denen sie ungestört experimentieren und forschen konnten. Einerseits waren sie dort weniger strengen Regeln unterworfen, andererseits nutzten sie die prekäre Lage der lokalen Bevölkerung, um sie für ihre Forschungszwecke zu missbrauchen. An dieser Stelle wird besonders deutlich, zu welcher Entmenschlichung koloniale Ideologie und kapitalistische Mehrwertproduktion führen. Der Mensch erschien nunmehr als Ware Arbeitskraft oder Forschungsobjekt. Die medizinischen Aktivitäten in den Kolonien nutzten die Kolonialmächte trotzdem als Aushängeschild, beispielhaft für die Fürsorge und das Verantwortungsbewusstsein der EuropäerInnen.
Ein anderes Beispiel aus der europäischen Wissenschaftsgeschichte
ist die Ethnologie. Forscher und Forscherinnen, die dem während der Kolonialzeit entstehenden Fach der Ethnologie zugerechnet wurden, beschäftigten sich mit den Menschen außerhalb Europas. Auch sie bewegten sich innerhalb eines kolonialen Machtgefälles und begegneten
Kolonisierten meist nicht auf Augenhöhe. Die Forschungsobjekte der Ethnologie, das waren vor allem Alltagsgegenstände, von denen man sich Aufschluss über die Lebensweise der Bevölkerung versprach, gelangten auf verschiedenen Wegen nach Europa. Manche Gegenstände wurden den Kolonisierten abgekauft,
andere ließen sie anfertigen, wieder andere wurden gestohlen. Der Umgang
mit gestohlenen oder sensiblen Ethnographika ist heute Gegenstand einer
Debatte, die nicht nur in der Ethnologie, sondern auch in der
Zivilgesellschaft geführt wird.
Das Forschungsinteresse der damaligen Humananthropologie, die sich im Kaiserreich aus der Medizin heraus entwickelt hatte, konzentrierte sich auf Fragen nach der „Rasse“. Sie waren vor allem interessiert, einen wissenschaftlichen Beleg für die Überlegenheit der eigenen „Rasse“ zu liefern. Dafür nahmen sie Vermessungen von Schädeln, aber auch dem ganzen Körper vor – Vermessungen, die häufig sehr schmerzhaft waren, weswegen man in den Kolonien gern auf Gefangene zurückgriff, die sich nicht wehren konnten. Dass aus der Schädelvermesserei schließlich auch die Disziplin der Eugenik entstanden ist, ist gemeinhin bekannt, genauso wie die verheerenden Folgen dieser Theorien.
Die AkteurInnen
Wir haben bereits festgestellt, dass mitnichten nur EuropäerInnen an der Produktion von Wissen und Wissenschaft beteiligt waren, sondern auch Kolonisierte. Aber kennen wir ihre Namen? Häufig nicht, denn aus den Quellen gehen diese meist nicht hervor. Ganz der Ideologie des Kolonialismus entsprechend, schien es den wenigsten europäischen ForscherInnen notwendig, die Namen derer zu erwähnen, die ihre Forschungen oft erst möglich machten. Das heißt, lokale WissenschaftlerInnen, Ortskundige, Menschen, die Gepäck auf Expeditionen trugen oder Pflanzen sammelten und viele andere mehr, verschwinden in den meisten Aufzeichnungen aus der Geschichte. Wenn von ihnen gesprochen wird, dann meist nur in Verbindung mit ihrer Funktion; man liest dann von namenlosen „Trägern“, „boys“ oder „alten Frauen“. In der Geschichtswissenschaft hat sich inzwischen der Begriff der Intermediaries etabliert. Er beschreibt eben diese Menschen, die am Prozess der Wissensgenerierung beteiligt waren, aber aufgrund von rassistischen, sexistischen, elitären oder klassistischen Strukturen keinen Platz in der Geschichte (des Wissens und der Wissenschaften) erhielten. Diese Personen wieder zu entdecken und zu benennen, ihre Wege, Motivationen und Beiträge nachzuvollziehen, ist die Aufgabe, vor denen die Geschichtswissenschaft heute steht. Oft ist das nicht einfach und man muss die Geschichte gegen den Strich bürsten, wie man in den postcolonial studies zu sagen pflegt, um etwas über die intermediaries herauszufinden. Das bedeutet ein intensives und aufmerksames Quellenstudium und manchmal auch einen langen Atem beim Durchsuchen von Archiven oder das Erlernen einer neuen Sprache. Darüber hinaus taucht hier noch ein weiteres Problem auf: die Wahl der Begrifflichkeiten. Denn die Begriffe, die von EuropäerInnen für Nicht-EuropäerInnen verwendet wurden, sind meist abwertend und rassistisch. Sie können also nicht einfach übernommen werden, denn sie sind wort-gewordene koloniale Ideologie. Diese müssen wir als Wissenschafterlnnen benennen und zitieren können, nicht aber in unseren eigenen Sprachgebrauch aufnehmen. Ein Problem bei der Wortwahl ist immer, dass manche Aspekte in einem abstrakten Begriff nicht mehr auftauchen. So kann man beispielsweise von ‚Kolonisierten‘ sprechen – eine recht neutrale Formulierung – allerdings reduziert sie eine Personengruppe auch auf eben dieses Merkmal, kolonisiert zu sein, während andere wichtige Eigenschaften nicht darin aufscheinen. Wann welcher Begriff sinnvoll scheint, variiert und ist kontextabhängig. Generell gilt, dass das Aufgreifen von Selbstbezeichnungen dem der Fremdbezeichnung vorzuziehen ist; auch hier kann man durch Sprache eine Perspektive sichtbar machen
Und heute?
Heute haben wir die Aufgabe, die koloniale Vergangenheit in unserem Alltag aufzuarbeiten. Wir wollen eurozentrische Perspektiven in Frage stellen und die alten Erzählungen von Heldentaten weißer Männer durchbrechen. Darüber hinaus müssen wir uns die Frage stellen: Welche Folgen hatte der Kolonialismus für die Wissenschaft, welche die Wissenschaften für die ehemaligen Kolonien? Im ersten Fall gilt es, vermeintlich Objektives auf koloniale Ideologie zu überprüfen und Fortführungen kolonialer Denkmuster zu entlarven: Welches koloniale Erbe hat die Universität an der ich studiere, die Schule auf dich ich gehe? Sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse, mit denen wir tagtäglich umgehen, frei von diesem Erbe? Und was wird überhaupt zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung gemacht? Im zweiten Fall stehen die ökonomischen, ökologischen und sozialen Folgen europäischer Expansion und Wissensproduktion im Vordergrund. Welche Folgen hatten das Klassifizieren von Tieren und Pflanzen für die Wahrnehmung der eigenen Umgebung, die Plantagenwirtschaft für die Beschaffenheit der Böden, die medizinischen Eingriffe für die PatientInnen? Mit welchen Folgen der kolonialen Wissensproduktion müssen die ehemals kolonisierten Länder noch heute umgehen? Diese und andere Fragen lassen sich hinsichtlich der Verknüpfung von Wissen(schaft) und Kolonialismus untersuchen. Darüber hinaus stellen sich auch ganz praktische Fragen in diesem Feld, zum Beispiel, wenn es um die Rückgabe von Objekten aus den ehemaligen Kolonien geht, die sich noch immer in europäischen Museen und Sammlungen befinden – eine Debatte die inzwischen auch Eingang in eine breite Öffentlichkeit gefunden hat.
Von Naima Tiné
Literaturhinweise
Arun Bara, The Dialogue of Civilizations in the Birth of Modern Science, New York 2006.
Harald Fischer-Tiné, Pidgin-Knowledge. Wissen und Kolonialismus, Zürich 2013.
Rebekka Habermas/Alexandra Przyrembel (Hrsg), Von Käfern, Märkten und Menschen. Kolonialismus und Wissen in der Moderne, Göttingen 2013.
David Harvey, The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Oxford 1990.
Kapil Raj, Relocating Modern Science. Circulation and the Construction of Knowledge in South Asia and Europe, 1650-1900, New York 2007.
Bernhard Schär, Wissenschaft und Kolonialismus 2016, Online unter: https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/postkolonialismus-und-globalgeschichte/219136/wissenschaft-und-kolonialismus (letzter Zugriff: 13.11.2019).